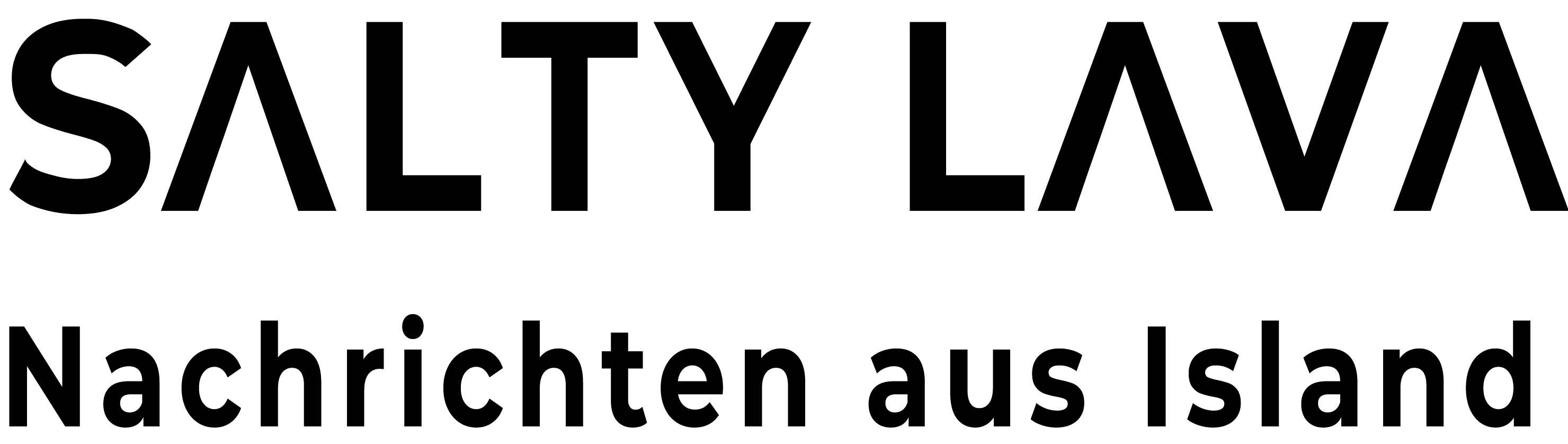Dennis Riege tv zusammen mit Bjarka Þór Kjartansson, Expertin in der Forschungsabteilung Forstwirtschaft, während der Recherche in Skarfanesi á Landi. Foto: Aðalsteinn Sigurgeirsson
Die vorläufigen Ergebnisse der Studie des amerikanischen Ökologen Dennis A. Riege deuten nicht darauf hin, dass die in der kommerziellen Forstwirtschaft in Island verwendeten Baumarten invasiv sind. Sie breiten sich langsam außerhalb von Waldgebieten und insbesondere auf erodiertem Land aus, setzen sich aber nicht dort durch, wo die Vegetation dicht ist. Dennis sagt, dass die isländische Birke sich viel effizienter ausbreiten kann als die Stabkiefer, die der Birke mit ihrem Schutz und ihren bodenverbessernden Eigenschaften möglicherweise dabei helfen kann, neue Länder zu erkunden.
 Diese vorläufigen Ergebnisse präsentierte Dennis Riege gestern, am 31. Oktober, in einem Vortrag in Mógilsá den Mitarbeitern der Forstwirtschaft. Derzeit lebt er mit einem Fulbright-Stipendium in Island und verfolgt ein Forschungsprojekt für die American Geographical Society Nationalgeographisch unterstützte ihn, damit er die Selbstaussaat importierter Baumarten in Island studieren konnte. Es bleibt, die Ergebnisse zu finalisieren und für die Veröffentlichung aufzubereiten.
Diese vorläufigen Ergebnisse präsentierte Dennis Riege gestern, am 31. Oktober, in einem Vortrag in Mógilsá den Mitarbeitern der Forstwirtschaft. Derzeit lebt er mit einem Fulbright-Stipendium in Island und verfolgt ein Forschungsprojekt für die American Geographical Society Nationalgeographisch unterstützte ihn, damit er die Selbstaussaat importierter Baumarten in Island studieren konnte. Es bleibt, die Ergebnisse zu finalisieren und für die Veröffentlichung aufzubereiten.
Die Forschungsfrage in Dennis‘ Projekt in Island war, ob importierte Baumarten in Island invasiv waren und damit eine Bedrohung für die isländische Natur darstellten, oder ob diese Arten vielleicht Retter gegen die Wüstenbildung waren, die in Island seit Jahrhunderten wütete. In einem Interview mit der Forestry-Website sagt er, dass die Ergebnisse in Island mit den Ergebnissen von Studien im Westen harmonieren, dass es keine theoretische Grundlage dafür gibt, Baumarten wie Stabkiefer, Sitka-Fichte und russische Lärche als invasiv zu definieren Isländische Natur.
„Ursprünglich kam ich in Begleitung meiner Frau hierher, die in der US-Armee war und in den Jahren 2000-2003 auf der Militärbasis am Flughafen Keflavík arbeitete“, sagt Dennis. „Damals hatte ich gerade meine Doktorarbeit abgeschlossen, in der es um die Erforschung von Sitka-Fichten, einschließlich Selbstaussaat, im Olympic National Park im US-Bundesstaat Washington ging. Ich nahm Kontakt mit Mógilsá auf, der Forschungsabteilung der Forstwirtschaft, und erfuhr, dass dort bereits Interesse daran besteht, die mögliche Selbstaussaat der Sitka-Fichte in Island zu untersuchen. Das führte unter anderem viele Jahre später zur Bewerbung um ein Stipendium bei National Geographic.“

Bäume breiten sich in dichter Vegetation nicht gut aus
Der Olympic National Park umfasst unter anderem Gebiete, in denen Landwirtschaft auf Farmen betrieben wurde. Dennis entdeckte bei seinen Recherchen zur Sitka-Fichte, die sich dort selbst aussät, dass es der Fichte sehr schwer fällt, sich in sehr gut gewachsene Gebiete einzusäen, zum Beispiel alte Felder, die trotz der Tatsache, dass die Bewirtschaftung vor vielen Jahrzehnten aufgegeben wurde, noch leer sind. „Ich bin auf der Suche nach Gebieten durch ganz Island gereist, um die Selbstaussaat importierter Arten zu studieren, aber besonders um Suður und Vesturland, Vestfjörður und den Osten von Hérað“, sagt Dennis. Hier wurden ähnliche Dinge aufgedeckt wie im westlichen Olympic National Park.
„Die einzige hier eingeführte Nadelbaumart, die effizienter als andere bei der Aussaat über kultivierte Waldstücke hinaus zu sein scheint, ist die Stabkiefer“, sagt Dennis. Beispiele für selbstgesäte russische Lärche und Sitka-Fichte sind an einigen Stellen zu finden, dies ist jedoch viel seltener. Nach seinen vorläufigen Ergebnissen scheinen zwei Dinge die Haupthindernisse für die Selbstaussaat importierter Baumarten in Island aus Waldgebieten zu sein. „Zunächst fällt ihnen das Klettern schwer, da die Vegetationsdecke sehr dicht ist. Die Samen keimen nicht und selbst wenn sie es tun, werden sie von anderen Pflanzen übertroffen. Zweitens gibt es die Konkurrenz mit der isländischen Birke, die bei der Aussaat viel effizienter ist und daher bei der Erkundung neuer Länder beispielsweise gegenüber der Stabkiefer normalerweise einen Vorteil hat“, sagt er. Außerdem scheint es den Nadelbaumarten sehr schwer zu fallen, sich in einem Birkenwald oder Birkengebüsch auszusäen. Demnach besteht keine erkennbare Gefahr, dass beispielsweise die Rotkiefer den Birkenwald übernehmen und die Birke vernichten könnte.
Birke ist viel selbstaussäender
aber die Kiefer kann der Birke helfen
 Es fällt nach der Feldforschung auf, sagt Dennis A. Riege, wie schwierig es war, Studienplätze zu finden, weil sich die eingeführten Arten überhaupt nicht stark ausbreiten. „Allerdings breitet sich die isländische Birke, die gut an die isländischen Bedingungen angepasst ist, stark aus“, sagt er. Wo die eingeführten Arten hingegen in der Nähe von beweideten, spärlich bewachsenen oder unbewachsenen Gebieten wachsen, zum Beispiel Mela und Ödland oder Straßenränder und andere gestörte Flächen, haben sie eine größere Chance, sich auszubreiten. Dies gilt insbesondere für die Stabkiefer, die wie die Birke eine Pionierpflanze ist. Dennoch sollte die Waldkiefer auf nährstoffarmen Böden langsamer wachsen und gedeihen als die Birke.
Es fällt nach der Feldforschung auf, sagt Dennis A. Riege, wie schwierig es war, Studienplätze zu finden, weil sich die eingeführten Arten überhaupt nicht stark ausbreiten. „Allerdings breitet sich die isländische Birke, die gut an die isländischen Bedingungen angepasst ist, stark aus“, sagt er. Wo die eingeführten Arten hingegen in der Nähe von beweideten, spärlich bewachsenen oder unbewachsenen Gebieten wachsen, zum Beispiel Mela und Ödland oder Straßenränder und andere gestörte Flächen, haben sie eine größere Chance, sich auszubreiten. Dies gilt insbesondere für die Stabkiefer, die wie die Birke eine Pionierpflanze ist. Dennoch sollte die Waldkiefer auf nährstoffarmen Böden langsamer wachsen und gedeihen als die Birke.
Mancherorts gibt es Hinweise darauf, dass die Stabtanne der Birke sogar dabei hilft, Wurzeln zu schlagen und auf schlechtem Boden zu wachsen, indem sie den Boden verbessert, sagt Dennis. „Ich denke, dass die Birke weiterhin die Art sein wird, die sich in Island am stärksten ausbreiten wird. Wir wissen jedoch, dass Island geografisch im Nadelwaldgürtel liegt. Nadelbaumarten konnten nach der letzten Eiszeit bisher einfach nicht hierher zurückkehren. Ich glaube, dass die Stabkiefer mit ihrem Schutz und ihren bodenverbessernden Eigenschaften der isländischen Birke helfen kann, sich in der überweideten und entbehrungsreichen Ödnis Islands auszubreiten“, fügt er abschließend hinzu.
Es wird spannend sein, die endgültigen Ergebnisse der Forschung von Dennis A. Riege zu sehen, wenn sie in von Experten begutachteten wissenschaftlichen Zeitschriften erscheinen.