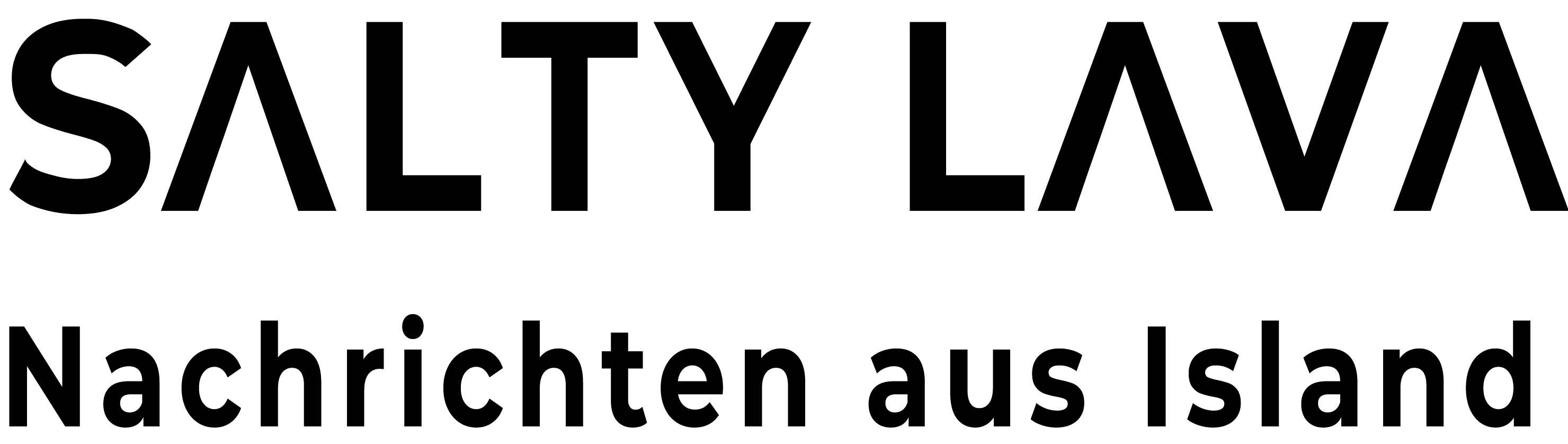Rögnvaldur Erlingsson und Hallgrímur Þórarinsson, Landwirte auf Víðivellir ytre I und II, pflanzten 1970 mit einem Spaten eine wurzelnackte Lärche. Foto: Halldór Sigurðsson – Fotosammlung von Skógræðinn
[Grein þessi birtist í Bændablaðinu 22. október 2020 og er birt hér með leyfi höfundar]
Am 25. Juni dieses Jahres war ein halbes Jahrhundert vergangen, seit Rögnvaldur Erlingsson und Hallgrímur Þórarinsson, Bauern in Víðivelli Ytre, die ersten Baumsetzlinge im Rahmen des sogenannten Fljótsdal-Programms gepflanzt hatten. Diese Anpflanzung markierte den Beginn der Farmwälder in Island, die heute etwa 21.000 Hektar umfassen und etwa die Hälfte der kultivierten Wälder des Landes ausmachen. In diesem Artikel wird an den Wendepunkt erinnert, indem die Vorgeschichte in Erinnerung gerufen und das Ergebnis untersucht wird.
Norwegische Wurzeln aus Örsta
Das Fljótsdal-Programm hatte einen langen Vorlauf. Seine Wurzeln liegen in Sunnmæri in Norwegen, wo Hans Berg, Bezirksförster in Örsta, 1950 den „Örsta-Plan“ vorlegte. Dieser führte zu Forstprojekten in Nordnorwegen und im Westen. Forstdirektor Hákon Bjarnason und Valtýr Stefánsson, Vorsitzender des isländischen Forstverbandes, orientierten sich an diesem norwegischen Plan, als sie in den 1960er Jahren die isländische Regierung ermutigten, in die Kultivierung von Nadelwäldern in Island zu investieren. Sie sprachen auf taube Ohren und die Herrscher hatten wenig Vertrauen, dass kommerzielle Forstwirtschaft in diesem Land betrieben werden könnte.
Auf der Generalversammlung des isländischen Forstverbandes im Jahr 1960 wurde erstmals offiziell vorgeschlagen, dass Landwirte mit geeignetem Land Subventionen für die Forstwirtschaft erhalten sollten. Nach wie vor bewegte sich das Thema wenig, da das forstwirtschaftliche Ideal angegriffen wurde, als der Anbau der norwegischen Waldkiefer scheiterte und im April 1963 schwere Kälteschäden an Bäumen im Süden auftraten.
Aufforstung mit Landwirtschaft präsentiert auf dem Treffen in Atlavík
Östlich von Fljótsdalshérað zeigten Lärchen gleichzeitig ein gutes Wachstum. Jónas Pétursson, Parlamentsabgeordneter für Austurland, legte 1965 einen parlamentarischen Entschließungsvorschlag vor, wonach der norwegische Forstdienst in Hallormsstaður mit der Züchtung von Lärchen für die Herstellung von Zaunpfählen beauftragt werden sollte, um den Bedarf der Bürger zu decken. Im selben Jahr lud der Vorstand von Skógræktarfélag Íslands Sigurð Blöndal, Förster in Hallormsstaður, und Þórarin Þórarinsson, Vorsitzende von Skógræktarfélag Austurland, zu einem Treffen ein, um ein mögliches Fljótsdal-Programm zu besprechen. Im Frühjahr untersuchte Sigurður die Zustimmung der Bauern in Fljótsdal zur organisierten Forstwirtschaft, und beim Atlavíkur-Treffen des Forstverbandes von Ostisland im Sommer 1965 stellte Einar GE Sæmundsen, Schatzmeister des isländischen Forstverbandes, die Idee vor, dass im 25 Jahren würden 1500 Hektar im Bezirk Fljótsdal für die Forstwirtschaft übernommen.
Die Finanzierung für den Bau von Zäunen erfolgte erst mit dem Budget von 1969. Im April dieses Jahres erhielten alle Landwirte in Fljótsdal einen Brief über die Aufforstung mit Landwirtschaft gemäß dem Fljótsdal-Programm, unterzeichnet vom Forstdirektor und den Vorsitzenden des Forstverbandes von Island und Austurland, wo im Mai ein Treffen einberufen wurde. Das Treffen in Végard war gut besucht. Im Juli besuchten Baldur Þorsteinsson und Sigurður Blöndal die Bauern, die bereit waren, an dem Projekt teilzunehmen, um die vorgeschlagenen Forstflächen zu inspizieren. Infolgedessen wurde beschlossen, im Herbst mit dem Bau von Zäunen im Land Víðivalla ytre zu beginnen. Der Zaun wurde am selben Tag geschlossen, an dem die Pflanzung begann, am 25. Juni 1970.
Die kommerzielle Forstwirtschaft gehört zu den Ressourcen des Landes
Die Verträge des Fljótdal-Programms sahen vor, dass der norwegische Forstdienst alle Anlaufkosten übernimmt, d. h. Zäune, Pflanzen und Bepflanzung. Bauern hingegen stellten das Land zur Verfügung, unterhielten Zäune und hatten Vorrang bei der Arbeit in der Forstwirtschaft. Die Forstwirtschaft sollte bei ihrer Nutzung 10 % des Bruttowerts der Waldprodukte erhalten.
Das Fljótsdal-Programm war von 1969 bis 1989 Teil des Budgets der Forstwirtschaft. Der Bau war kleiner als ursprünglich erwartet, aber das Projekt erstreckte sich bald über die Grenzen des Fljótsdal-Distrikts hinaus. Die am Fljótsdal-Programm beteiligten Länder waren: Víðivellir yytri I und II, Brekka, Geitagerði, Hjarðarból, Víðivallagerði, Vallholt, Skriðuklaustur, Melar und Droplaugarstaðir sowie vier Länder in Vallahreppi: Gunnlaugsstaðar, Mjóaness, Strandar und Vallaness.
Zehn Jahre nachdem die ersten Bäume in Víðivellir gepflanzt wurden, waren erste Ergebnisse sichtbar, und in Hallormsstaður konnte den Menschen gezeigt werden, wie diese Haine in Zukunft aussehen würden. Das Vertrauen der Menschen in die kommerzielle Forstwirtschaft wuchs stetig, und im Landgewinnungs- und Landschutzprogramm 1982–1986 wurden Mittel für Forstwirtschaftsprogramme der Distrikte bereitgestellt. 1984 wurde dem Forstgesetz ein neuer Abschnitt über Wirtschaftswälder auf landwirtschaftlichen Betrieben hinzugefügt. Diese ermächtigte den Staat, unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 80 % der Gründungskosten einer solchen Forstwirtschaft zu übernehmen. Im Auðlindir-Bericht zur Jahrhundertwende, der 1986 von einer vom Premierminister ernannten Gruppe erstellt wurde, wurde der Forstwirtschaft ein besonderes Kapitel gewidmet, in dem es heißt, dass die kommerzielle Forstwirtschaft eine praktikable Option ist und „eine wichtige makroökonomische Auswirkung haben kann und gut zu anderen Landnutzungen passen, einschließlich Erholung im Freien, Sommerresidenzen und verschiedenen Zweigen der Landwirtschaft“.
Fljótsdals Plan komplett mit Héráðsskóg
In der Region wuchs das Interesse an verstärkter Forstwirtschaft, nicht zuletzt zeitgleich mit dem Rückgang der Schafzucht und Einschnitten durch Scrapie. Im Frühjahr 1989 billigte Alþingi einen parlamentarischen Beschluss der Abgeordneten Ostislands, wonach der Landwirtschaftsminister mit der Ausarbeitung eines 10-Jahres-Plans zur Förderung der Forstwirtschaft in Fljótsdalshérað beauftragt werden sollte. Fast ein Jahr später wurde eine Task Force eingesetzt, um an den Fortschritten der parlamentarischen Resolution zu arbeiten, und am 27. Mai 1989 stimmte die isländische Regierung zu, „dass alle nutzbaren Forstflächen in Fljótsdalshérað in den nächsten 40 Jahren mit Wald bedeckt sein sollten „. Es wurden Treffen mit Einwohnern von Eiðahreppi, Egilsstaðahreppi, Vallahreppi, Skriðdalshreppi, Fljótsdalshreppi und Fellahreppi abgehalten, um die Gedanken der Bauern zu erforschen. Die Aufnahme war positiv und die meisten, die am Fljótsdal-Programm teilgenommen hatten, wollten direkt in das neue Projekt einsteigen. Im Herbst wurde ein Bericht über Héraðsskóga in Fljótsdalshérað vorgelegt und ein Zehnjahresbudget für das Projekt erstellt. Die Budgets waren jedoch geringer als erwartet, und die Regierung zögerte noch immer. 1990 wurde ein 40-Jahres-Kosten- und Ausführungsplan für 15.000 Hektar Untergrund erstellt, ein Gesetzesentwurf über Héráðsskógi und Verträge mit Landwirten erstellt. Man ging damals davon aus, dass bis zu 90 Grundstückseigentümer bereit seien, sich an dem Projekt zu beteiligen. Das Gesetz über Hérádsskógi wurde schließlich am 11. März 1991 von Alþingi genehmigt. Damit war der fruchtbare Nachwuchs des Fljótsdal-Programms geboren, und im Laufe des nächsten Jahrzehnts wurden landesweit regionale Forstprojekte ins Leben gerufen. Mit organisatorischen und rechtlichen Änderungen im Jahr 2016 wurden diese Projekte alle unter einer neuen Organisation, Forstwirtschaft, zusammengefasst.
Verdoppelung der Waldfläche in 60 Jahren
In den 1960er Jahren träumten isländische Pioniere davon, dass 80 % des Holzbedarfs der Isländer durch die Kultivierung von Nadelwäldern gedeckt werden könnten. Isländisches Holz wiegt immer noch wenig gegen Importe, aber die Wälder sind gewachsen und die Vorteile nehmen zu. Isländisches Industrieholz, das zum Beispiel bei der Herstellung von Siliziummetall verwendet wird, ist in den letzten Jahren mit importiertem Holz gleichgezogen. Aber die Wälder des Landes haben noch einen langen Weg vor sich, um den Bedarf an Schnittholz zu decken. Die Ergebnisse sind noch sichtbar. Vor 60 Jahren betrug die Waldbedeckung des Landes weniger als 1 %. Natürliche Birkenwälder bedecken heute etwa 1,5 % der Fläche Islands, oder 155.000 Hektar. Kulturwald ist etwa 43 Tausend. Hektar, so dass Islands Wälder insgesamt etwa 2 % des Landes oder fast 4 % des Tieflandes bedecken.
Heute ist es die offizielle Politik, Waldressourcen aufzubauen und mindestens 5 % des Tieflandes des Landes für die Förderung von Siedlungen auf dem Land und die Steigerung der Holzproduktion zu nutzen. Es ist davon auszugehen, dass die Forstwirtschaft aufgrund der Kohlenstoffbindung zur Bekämpfung des Klimawandels in den kommenden Jahren auch Fisch anbauen wird, und die Waldbauern können sich daran beteiligen. In Héráð hat die Waldbedeckung des Tieflandes etwa 20 % erreicht und die Holzmenge in den Wirtschaftswäldern nimmt von Jahr zu Jahr zu. Der Holzbestand in den Wirtschaftswäldern des Hérád wird auf etwa 292.000 geschätzt. Kubikmeter im Jahr 2024. Dies bedeutet, dass ein immer größerer Teil des gefällten Waldes zu wertvollen Holzprodukten wie Tafelholz wird, was dann zu weniger Importen dieses Produkts führt.
Ein halbes Jahrhundert ist eine kurze Zeit im Leben eines Waldes
Mjór ist ein guter Indikator und die 8.000 Lärchenpflanzen, die vor einem halben Jahrhundert auf Víðivellir ytter in Fljótsdal gepflanzt wurden, sind zu wertvollen Bäumen geworden, die zu Tafelholz verarbeitet werden. Passenderweise wurde auf demselben Hof ein auf die Verarbeitung von Waldprodukten spezialisiertes Unternehmen errichtet. Das Fljótsdal-Programm hat somit seinen Wert bewiesen und gezeigt, dass die Forstwirtschaft als landwirtschaftlicher Betrieb in Island ebenso wie in Nordnorwegen eine praktikable Option ist.
Aber ein halbes Jahrhundert ist eine kurze Zeit im Leben eines Waldes, und die Generation, die pflanzt, erlebt selten die Früchte ihrer Arbeit. Die aufgeschlossenen Bauern, die 1970 Land unter den fernen Traum von Wirtschaftswäldern legten, haben sich verabschiedet, aber jüngere Generationen haben diese natürliche Ressource neuer Zeiten angenommen. Wenn in weiteren fünfzig Jahren das 100-jährige Bestehen der bäuerlichen Forstwirtschaft gefeiert wird, wird aller Voraussicht nach die dritte Generation die größten Früchte tragen. Dann wird es „glänzende schöne Wälder geben, die Hügel und Berge schmücken“, wie der berühmte Hákon Aðalsteinsson, Waldbauer in Húsum in Fljótsdal, in seinem Gedicht über die Zukunftsvision des Waldbauern feststellte. Es ist angebracht, den Artikel mit der letzten Strophe dieses Gedichts zu beenden.
Übersetzt in Birkenblätter
das Gefühl eines Sommertages.
Klingt in fröhlichen Herzen
charmante Hymne.
Eine Vision der Zukunft, die ich sehe.
Ich bringe das Land zum Klingen
der schöne Klang der Trompete
ein Engel in seinem eigenen Baum.
Björn Gunnarssons Schule
Verband der Waldbauern im Osten